Die Evolutionstheorie soll erklären, wie alle Lebewesen entstanden sind. Sie deckt demnach also auch die Evolution des Menschen ab. Es wäre leicht anzunehmen, dass diese funktioniert, indem den Organismen ständig neue Merkmale hinzugefügt werden und sich ihre Komplexität so steigert. Fische entwickeln Beine, Dinosauriern wachsen Flügel und wir entwickelten uns schließlich vom Affen zum Menschen. Forscher stellen jetzt klar: Diese Vorstellung ist ein Irrtum.
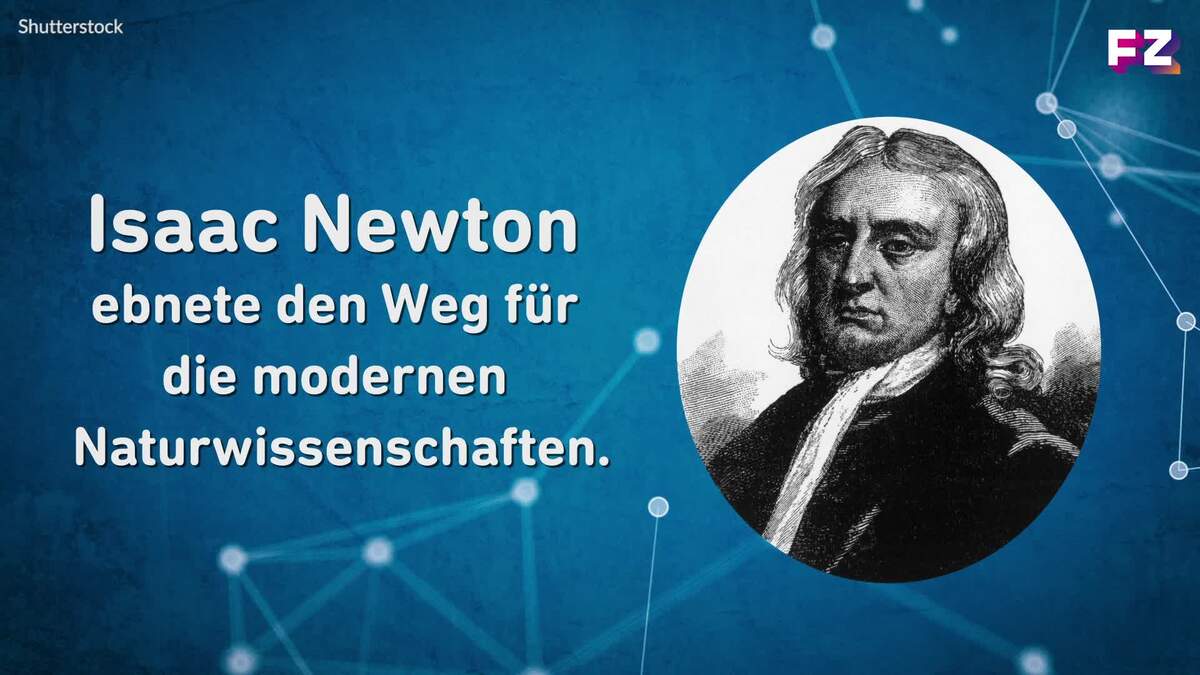
Evolutionstheorie: Dieser Irrtum frustriert die Forscher
Obwohl viele Menschen davon ausgehen, dass die Evolutionstheorie einen geradlinigen Verlauf vorsieht, der uns vom Affen zum Menschen werden lassen hat, gibt es auch Lebewesen, die ohne eine Weiterentwicklung erfolgreich überleben oder sogar ihre Komplexität im Laufe der Zeit wieder reduziert haben. Ein Paradebeispiel dafür sind Parasiten.
In einer kürzlich von Nature.com veröffentlichten Studie wurden die vollständigen Genome von über hundert Organismen (meist Tiere) verglichen, um herauszufinden, wie das Tierreich sich auf der genetischen Ebene entwickelt hat. Dabei fanden die Forscher heraus, dass die Entstehung größerer Tiergruppen wie beispielsweise der des Menschen garnicht mit der Ergänzung neuer Gene, sondern eher mit Genverlusten verbunden sei.
Gedankenexperiment verdeutlicht falsche Annahme
Evolutionsbiologe Stephen Jay Gould, einer der stärksten Gegner der fälschlichen Annahme, die Evolutionstheorie funktioniere nur durch das Hinzufügen neuer Gene, verwendet dabei ein interessantes Modell. Ein Betrunkener verlässt eine Bar und taumelt zwischen ihr und einem Bahngleis hin und her. Das Leben entsteht beim Verlassen der Bar mit der geringstmöglichen Komplexität. Manchmal stolpert er zufällig in Richtung der Gleise, was eine Zunahme seiner Komplexität zur Folge hat und ein anderes Mal zurück in Richtung der Kneipe, was die Komplexität reduzieren würde. Was besser zum Überleben ist, ist also von der jeweiligen Umgebung abhängig.
In einigen Fällen entwickeln Tiere derart Komplexe Merkmale, die die Funktionsweise ihrer Körper beeinträchtigen. Dann ist es nicht mehr möglich, diese Gene loszuwerden, um so ihre Komplexität zu reduzieren. Bezogen auf das Beispiel würden diese also „zwischen den Gleisen stecken bleiben“. Der Ansatz, dass es bei der Evolutionstheorie immer nur in eine Richtung geht, ist demzufolge ein Irrtum.
Der Baum des Lebens ist der Schlüssel
Bei den Untersuchungen der Forscher stellte diese Erkenntnis den Grundbaustein für die weitere Vorgehensweise dar. Sie untersuchten eine vielfältige Auswahl an Organismen und sahen nach, wie diese im sogenannten Baum des Lebens miteinander verwandt sind und welche Gene sie gemeinsam haben und welche eben nicht. War ein Gen in einem älteren Ast vorhanden, im jüngeren jedoch nicht, wurde auf einen Verlust von diesem geschlossen. Andersherum konnte bei dem Auftauchen eines neuen Gens davon ausgegangen werden, dass dieses durch eine Zunahme der Komplexität gewonnen wurde.
Die Untersuchungen wurden zusammen mit Peter Holland von der Oxford Universität durchgeführt und wiesen eine noch nie dagewesene Anzahl verlorener und gewonnener Gene auf. Vergleicht man diese mit dem Gedankenexperiment von Gould, kommt man bei der Evolutionstheorie zu folgendem Schluss: Das Tierleben machte beim Verlassen des Pubs einen großen Komplexitätssprung. Nach der anfänglichen Begeisterung stolperten einige Abstammungslinien wieder näher an die Kneipe, während andere durch den Gewinn von Genen die Gleise überqueren konnte. Die Evolution vom Affen zum Menschen ist also nicht ganz so geradlinig, wie bislang vermutet wurde.
Auch andere spannende Fragen hinsichtlich der Evolutionstheorie konnten bereits geklärt werden. Was war zuerst da: Huhn oder Ei? Warum uns Charles Darwins Menschenbild auch heute noch so prägt, erfährst du hier.

