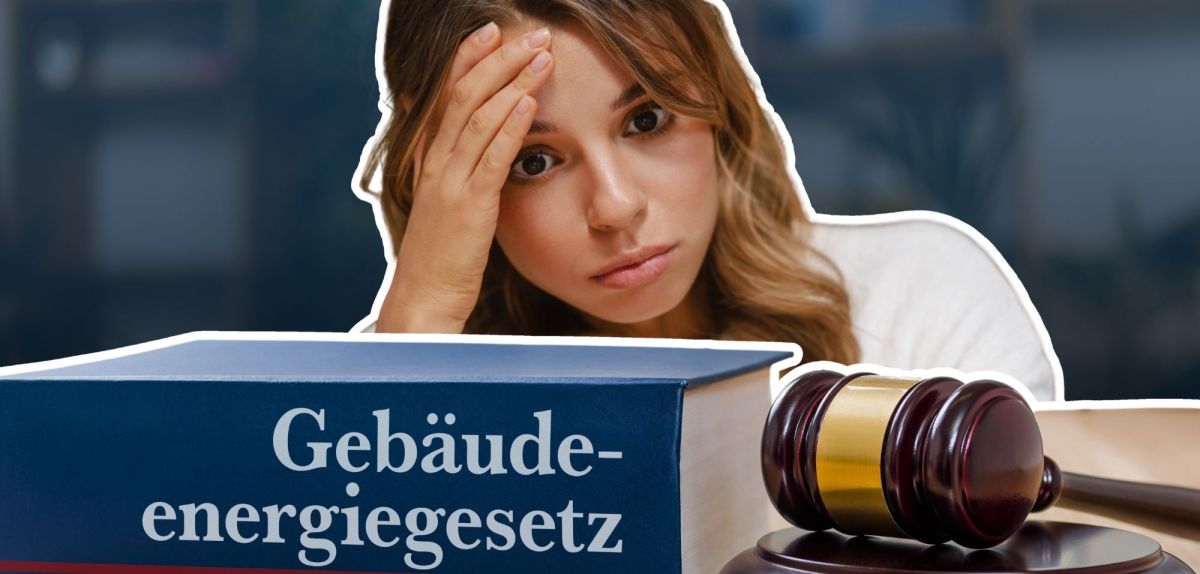Das 2023 novellierte, weithin als Heizungsgesetz bekannte Gebäudeenergiegesetz (GEG) hat bei vielen Menschen für Verunsicherung gesorgt. Rund um das Thema Heizen kursieren zahlreiche Irrtümer und Lügen. Julian Schwark, Schornsteinfeger und zertifizierter Energieberater, kennt sie alle – und räumt mit den fünf häufigsten Mythen auf, die ihm in seinem Berufsalltag begegnen.
Mythen und Lügen zum Heizungsgesetz
Viele der kursierenden Behauptungen sind nicht nur schlicht falsch, sondern werden gezielt von politischen Gegnerinnen und Gegnern des Heizungsgesetzes aufgegriffen und instrumentalisiert. In hitzigen Debatten dienen diese Narrative dazu, Unsicherheit zu schüren und die notwendige Transformation im Gebäudesektor zu diskreditieren – auf Kosten einer faktenbasierten Diskussion.
Die Folgen sind gravierend: Hausbesitzer*innen verschieben wichtige Investitionen, Handwerksbetriebe kämpfen mit Einbrüchen bei Wärmepumpenaufträgen, und die öffentliche Debatte verliert an Orientierung. Umso wichtiger ist es, die am häufigsten verbreiteten Heizungsmythen sachlich und fundiert aufzuklären.
N° 1: Wärmepumpen funktionieren nicht im Altbau
Ein besonders hartnäckiger Irrglaube lautet, dass Wärmepumpen in Altbauten nicht einsetzbar seien. Doch das ist falsch.
„Wärmepumpen können auch Altbauten beheizen, im Zweifel nur weniger ökonomisch sinnvoll“, erklärte Schwark der Berliner Morgenpost. Je höher die Temperatur, die ein Gebäude benötigt, desto geringer sei der Wirkungsgrad. Aber grundsätzlich funktionierten Wärmepumpen auch in älteren Gebäuden – sogar in der Industrie gebe es Modelle, die eine Vorlauftemperatur von über 100 Grad Celsius erreichten. Die Technik funktioniere – ob sie sich rechne, sei eine andere Frage.
Diese Einschätzung wird durch eine Feldstudie des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) gestützt. Dabei wurden rund 75 Wärmepumpen in Altbauten getestet – mit durchweg positiven Ergebnissen. Die ermittelten Jahresarbeitszahlen lagen zwischen 2,4 und 5,2.
Wärmepumpen sind auch im Altbau erlaubt und technisch einsetzbar. Laut § 71 GEG ist die Nutzung von 65 % erneuerbarer Energie verpflichtend bei neuen Heizungen – wie sie durch Wärmepumpen erreicht werden kann. Altbauten sind nicht ausgeschlossen, bei technischer oder wirtschaftlicher Unzumutbarkeit greifen Ausnahmen (§ 71k GEG).
Weiterlesen: Wärmepumpe: Hausbesitzer begehen fatalen Denkfehler
N° 2: Das Heizungsgesetz verbietet Gas- und Ölheizungen
Viele glauben, dass Heizsysteme mit Gas oder Öl inzwischen verboten seien. Doch Schwark stellt klar: „Ich darf solche Anlagen einbauen und sie auch bis 2045 betreiben.“
Die Ampel-Regierung habe die Anfang 2024 in Kraft getretene GEG-Novelle so gestaltet, dass sie möglichst technologieoffen bleibe – auch für Öl- und Gasheizungen. Man dürfe also weiterhin solche Anlagen einbauen und bis zum Jahr 2045 betreiben. Ab dem Jahr 2029 gelte jedoch die Verpflichtung, einen Anteil biogenes Gas über den Gasvertrag zu beziehen: zunächst 15 Prozent, bis 2045 dann 100 Prozent.
Neue Heizungen müssen – je nach regionalem Stand der Wärmeplanung – ab 2026 oder 2028 den Anteil erneuerbarer Energien erfüllen. Gasheizungen bleiben erlaubt, wenn sie entsprechende Beimischungen ermöglichen. Eine weitere Reform ist in der Diskussion, aber noch nicht beschlossen.
Das GEG verbietet fossile Heizungen nicht, sondern verlangt schrittweise eine Beimischung erneuerbarer Energieträger (§ 71m GEG). Neue Heizungen müssen ab 2024 65 % erneuerbare Energien nutzen (§ 71 GEG), Gasheizungen dürfen weiter eingebaut werden – unter Auflagen und Beratungspflicht (§ 71l GEG).
Weiterlesen: Merz‘ Heizungsgesetz: Das kommt jetzt auf Eigentümer und Mieter zu
N° 3: Wärmepumpen sind zu laut
Viele Menschen haben Sorge, dass Wärmepumpen Lärm verursachen – vor allem in dicht bebauten Wohngebieten.
„Relevant ist die Frage nur bei Luft-Wasser-Wärmepumpen, nur die haben eine Außeneinheit mit Ventilator, der Schall verursachen kann“, so Schwark. „Ob das störend ist, hängt zu großen Teilen von der Planung im Vorfeld ab.“ Wichtig sei der richtige Standort: Man solle die Außeneinheit beispielsweise nicht direkt unter ein Schlafzimmerfenster stellen. Es gebe gesetzliche Lärmgrenzen, und die Hersteller überträfen sich inzwischen mit besonders leisen Modellen.
Da der Markt für Wärmepumpen aktuell stark unter den politischen Debatten leide – laut Branchenverbänden sei der Absatz im Jahr 2024 deutlich rückläufig –, setzten viele Hersteller auf neue Anreize: leisere Systeme, einfachere Installation und stärkere Kooperationen mit Handwerksbetrieben. Ziel sei es, das Vertrauen der Nutzenden wieder zu stärken.
Wärmepumpen dürfen nur betrieben werden, wenn die Geräuschentwicklung keine schädlichen Umwelteinwirkungen verursacht. Die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) legt dafür Immissionsrichtwerte je nach Gebietstyp (z. B. Wohngebiet, Mischgebiet) und Tageszeit fest. Der Einbauort und die Gerätewahl sind entscheidend, ob Grenzwerte eingehalten werden.
Weiterlesen: Heizungsgesetz: Merz‘ Wortbruch trifft Millionen Haushalte
N° 4: Solarthermie und -energie machen unabhängig
Oft höre Schwark Sätze wie: „Ich hab jetzt eine PV-Anlage auf dem Dach, ich bin sicher, wenn ein Blackout kommt.“ Doch das sei nur selten der Fall.
Nur sogenannte inselfähige Photovoltaikanlagen – also solche mit Notstromfunktion – könnten bei einem Stromausfall wirklich einspringen. Die meisten Anlagen seien dafür nicht ausgelegt. Wenn man Unabhängigkeit wolle, müsse man das schon bei der Planung berücksichtigen.
„Der Autarkie-Gedanke hat übrigens in der Energiekrise auch dazu geführt, dass viele Leute sich eine dezentrale Holzfeuerstätte, also einen Kamin oder Ähnliches, geholt haben“, so Schwark weiter.
Seit dem Jahr 2024 gebe es zudem neue Fördermöglichkeiten für erneuerbare Energien. Über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) könne man Zuschüsse von bis zu 70 Prozent für klimafreundliche Heizsysteme wie Wärmepumpen oder hybride Anlagen beantragen – insbesondere dann, wenn alte Heizsysteme ersetzt oder besonders effiziente Lösungen gewählt würden.
Photovoltaik und Solarthermie können zur Erfüllung der 65 %-Pflicht beitragen (§ 71 i. V. m. § 36 GEG), machen aber nur mit Notstromfunktion wirklich unabhängig. Eine hohe Eigenversorgung ist möglich, vollständige Autarkie bleibt selten – ist jedoch bei richtiger Planung erreichbar.
Weiterlesen: Neue Heizung ab 2025: Diese Kosten kennt fast niemand
N° 5: Holz ist ein schmutziger Brennstoff
Holz gelte oft als umweltschädlich – doch laut Schwark stimme das so nicht.
„Holz unterliegt starken gesetzlichen Reglementierungen, wie dreckig es in der Verbrennung sein darf“, sagt er. „Da gibt es Grenzen, wie viel Feinstaub eine Feuerstätte verursachen darf.“ Beim Verbrennen von Holz entstehe Kohlenstoffdioxid – aber nur das, was der Baum zuvor gespeichert habe. Moderne Anlagen hielten die Grenzwerte ein, oft mithilfe von Filtern.
Probleme entstünden in der Praxis meist nicht durch den Ofen selbst, sondern durch die falsche Nutzung: Wer nasses Holz oder sogar Müll verbrenne, verursache unnötige Emissionen und Ärger mit der Nachbarschaft.
Holzheizungen sind zugelassen und unterliegen strengen Grenzwerten (geregelt v. a. durch 1. BImSchV). Das GEG erlaubt sie als erneuerbare Energiequelle (§ 71 GEG). Entscheidend für die Umweltverträglichkeit sind moderne Technik und korrektes Nutzungsverhalten.
Weiterlesen: Heizen mit Kamin: Wer das übersieht, zahlt tausende Euro
„Man will mir das Heizen verbieten“
Die Wärmewende bleibt ein zentrales Thema – für Politik, Wirtschaft und alle, die Verantwortung für ein Zuhause tragen. Trotz aktueller Debatten und Unsicherheiten ist klar: Niemand will dir das Heizen verbieten, sondern Wege finden, es klimafreundlicher, effizienter und langfristig bezahlbar zu gestalten. Umso wichtiger ist es, Mythen und Fehlinformationen kritisch zu hinterfragen – besonders, da politische Gegner des Heizungsgesetzes diese gezielt instrumentalisieren, um Stimmung zu machen und Verunsicherung zu schüren.
Wer heute in moderne Heiztechnologien investiert, profitiert nicht nur von staatlichen Förderungen, sondern auch von mehr Unabhängigkeit und Zukunftssicherheit. Lass dich also nicht von Schlagzeilen oder Halbwahrheiten leiten – sondern von Fakten, Fachberatung und einem Blick auf die langfristigen Vorteile für dich und das Klima.
Quelle: Berliner Morgenpost; Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme; Gebäudeenergiegesetz; Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm
Seit dem 24. Februar 2022 herrscht Krieg in der Ukraine. Hier kannst du den Betroffenen helfen.